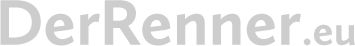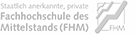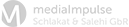Lokales
Zwischen Felsen und Freiheit: Bouldern im Frankenjura
Kleine Blöcke, große Herausforderungen: Bouldern verbindet Kraft, Technik und Köpfchen – in Hallen oder in der Natur. In Franken entsteht dabei ein Spannungsfeld zwischen Sport, Naturschutz und Verantwortung.
(Bayreuth.) Bouldern begeistert seit Jahrzehnten Sportler*innen weltweit. Der Deutsche Alpenverein (DAV) beschreibt Bouldern als „Klettern ohne Seil in Absprunghöhe“, also in einer Höhe, die ein sicheres Abspringen ermöglicht.
Der Begriff kommt vom englischen „boulder“, also einem kleineren Felsblock. Die Routen liegen in bis zu viereinhalb Metern Höhe und dicke Weichbodenmatten, auch „Crashpads“ genannt, schützen vor Verletzungen bei einem Sturz. Ziel ist es unterschiedliche „Probleme“ zu lösen und den Topgriff drei Sekunden lang mit beiden Händen zu halten. Der Sport kombiniert Maximalkraft, Athletik, Beweglichkeit und Koordination und strategisches Denken und ist dank verschiedener Schwierigkeitsgrade für nahezu jedes Alter und sportliches Niveau geeignet. Boulderhallen markieren diese meist farblich, während draußen andere Systeme, wie die Fontainebleau-Skala in Europa, verwendet werden.
Die Geschichte des Boulderns
Erste Belege von Kletternden, die ohne Sicherung am Felsen hingen, reichen ins späte 19. Jahrhundert. Als Ursprungsgebiet gilt das sandsteinreiche Waldgebiet bei Fontainebleau. Dort trainierten etwas später junge Alpinisten das Bouldern, um für Gebirgstouren zu trainieren. Sie wurden als die „Bleausards“ bekannt. Der US-Amerikaner John Gill etablierte die Sportart als solche in den 1950er Jahren. Als Turner entdeckte er Bouldern für sich als Trainingsvorteil und prägte Techniken mit Elementen aus dem Geräteturnen. Er nutzte erstmals Magnesium auf den Handflächen für besseren Grip und entwickelte eine Bewertungsskala, die den Sport entscheidend voranbrachte. In Deutschland machte der Nürnberger Wolfgang „Flipper“ Fietz das Bouldern populär. In den 1970er und 80er Jahren prägte er die Sportart vor allem in der Fränkischen Schweiz und gehörte mit seinen Erfolgen zu den besten Kletterern seiner Zeit.
In den 1990er Jahren erlebte der Boulder-Sport einen Boom. Die ersten industriell gefertigten „Crashpads“, wie sie heute genutzt werden, kamen auf den Markt, zahlreiche Bouldergebiete wurden weltbekannt und 1999 fand der erste Weltcup statt. Durch immer mehr neue Indoorhallen wuchs das Bouldern immer mehr zum Breitensport heran. Heute gibt es in Deutschland fast 600 öffentliche Boulder- und Kletteranlagen und mehr als 500 000 Boulder*innen. Allerdings üben nur rund 30% den Sport auch am Naturfelsen aus.
Mitglieder der Boulder-Community aus Bayreuth geben einen Einblick über die Herausforderungen und Vorteile am Felsen und Vorzüge einer Boulderhalle:
Bouldern in Bayerns Natur
Die beliebten Kletter- und Boulderfelsen im Frankenjura und dem Fichtelgebirge in Bayern bieten eine besondere Naturbeschaffenheit. Ein Besuch führt nicht selten in eines der vielen Schutzgebiete: Naturschutzgebiete, Vogelschutzgebiete, Naturparks oder vor allem Flora-Fauna-Habitate. Der Olympiasportler und gebürtige Franke Alexander Megos sagt sogar: „das Frankenjura ist das geilste Klettergebiet der Erde.“
Grundsätzlich gilt im Frankenjura für alle Menschen das Recht zur freien Betretung der Natur. Geregelt wird der Anspruch in Artikel 142 der bayrischen Verfassung, sowie in Artikel 27 des Bayrischen Naturschutzgesetzes. Auch sportliche Betätigungen, einschließlich Klettern und Bouldern, sind erlaubt. Dieses Recht kann jedoch eingeschränkt werden, wenn der Naturschutz gefährdet wird. So ist Bouldern in Höhlen durch § 39 des Bundesnaturschutzgesetztes von Oktober bis einschließlich März untersagt, um die Winterquartiere von Fledermäusen nicht zu stören. In Naturschutzgebieten gilt oft ein Wegegebot und das Bouldern an bestimmten Felsen kann untersagt werden. Auch Eingriffe in die Natur, wie das Bauen von Podesten, sind verboten.
Der Boulderappell
Die Boulder-Community zog es immer öfter nach Bayern. Die Aufmerksamkeit führte zu Kritik seitens der Anlieger, Grundstückbesitzer und der Jagd- und Forstwirtschaft. Auch die Behörden wurden auf den Sport aufmerksam und suchten nach geeigneten Kompromissen. Der IG Klettern Frankenjura, Fichtelgebirge und Bayrischer Wald e.V. und der DAV veröffentlichten im Jahr 1998 den ersten Boulderappell für den nördlichen Frankenjura und das Fichtelgebirge in Abstimmung mit den Naturschutzbehörden.
Der IG Klettern erklärt: „Ein Appell hat keine Rechtsverbindlichkeit, er ist ein Aufruf sich an bestimmte Regeln zu halten. Ziel des Boulderappells ist es, durch freiwillige Selbstbeschränkung hoheitliche Maßnahmen in Form von Verboten zu verhindern.“ Der Appell wurde 2010 zuletzt erneuert und hält sich bis heute. Er ruft unter anderem dazu auf keine Bouldergebiete oder Boulderführer zu veröffentlichen, keine Boulderkurse anzubieten oder Boulder nicht zu markieren oder beschriften. Außerdem sollte auf die natürlichen Gegebenheiten und Lebensräume Rücksicht genommen werden, sowie nicht in Höhlen bouldern, keine Aktivitäten mehr nach Einbruch der Dämmerung und jegliche Veränderung der natürlichen Felsen. Der Sportler Henrick Acker klettert und bouldert leidenschaftlich seit 2007. Im Jahr 2016 zog er nach Bayreuth und sammelt seine Erfahrungen beim Bouldern in der Natur. Nun spricht er über die Hintergründe des Boulderappells und seine bestehende Relevanz für lokale Boulder*innen.
Freiwillig, umstritten und unverzichtbar?
Der Boulderappell setzt auf freiwillige Selbstverpflichtung – ein Ansatz, der zwar Konflikte vermeiden soll, aber nicht unumstritten ist. Kritiker*innen bemängeln die fehlende Verbindlichkeit und zweifeln daran, dass Verstöße ausreichend kontrolliert werden. Auch die Formulierungen gelten teils als zu vage, sodass Grenzen in der Praxis oft verschwimmen. Zudem erreicht der Appell vor allem ohnehin umsichtige Boulder*innen, während Gelegenheitsbesucher*innen oder Tourist*innen häufig nichts davon mitbekommen. Die Maßnahmen wirken mitunter einseitig, da auch andere Nutzergruppen wie Wandernde oder sonstige Sportler*innen Verantwortung für den Naturschutz tragen.
Als Alternative wird die Einführung eines Boulderkonzepts diskutiert. Ähnlich wie beim bestehenden Kletterkonzept müssten dafür alle Boulderfelsen erfasst werden, in Zonen eingeteilt und teilweise beschildert werden. Angesichts der Größe der Gebiete erscheint die Umsetzung den örtlichen Behörden und Kletterverbänden jedoch kaum machbar. Teilverbote würden andere Gebiete umso stärker belasten und vermutlich für größeren Widerstand von der Boulder-Community sorgen.
Der IG Klettern befürwortet daher eine Aktualisierung des aktuellen Appells, da „behördlich angeordnete Lenkungsmaßnahmen zu einer stärkeren Einschränkung des Boulderns als freiwillige Selbstbeschränkung [führen]“. Mit Anpassungen an heutige Gegebenheiten und bessere Informationswege in der Szene kann Naturschutz und Bouldersport auch zukünftig im Einklang stehen.
Ein Bericht von Elina Memmert als Prüfungsleistung im Modul Crossmediale Medienkommunikation & Konzeption – BA-MJ-69-H-VZ
Quellen:
https://www.alpenverein.de/thema/bouldern
https://www.deine-gesundheitswelt.de/sport-bewegung/trendsport-bouldern
https://www.ispo.com/know-how/ungesichert-der-wand-die-geschichte-des-boulderns#:~:text=Ursprung%20des%20Boulderns,als%20%E2%80%9EUrvater%20des%20Boulderns%E2%80%9C.
https://www.outdoor-magazin.com/klettern/bouldern-und-wie-es-dazu-kam/
https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2020-755/
https://kletterszene.com/news/frankenjura-das-geilste-klettergebiet-der-erde/
Schlagworte: Bayern, Bouldern, Franken, Klettern, Nachhaltigkeit, Naturschutz, Outdoorsport